Inklusion
Langfristige Beschäftigungsmodelle
Sie zielen darauf ab, Menschen mit Beeinträchtigung dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Der endgültigen Beschäftigung geht immer eine längere Phase der Arbeitserprobung und Einarbeitung voraus, die über ein bis drei Jahre gehen kann. Fast immer ist eine sogenannte "Werkstattbefähigung" Voraussetzung. Dies ist nur eine von vielen Vorgabe, die der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Beschäftigungsmodelle vorsieht. Sich darüber genaue Kenntnisse zu verschaffen, ist ein "Muss" für Betriebe, die Menschen mit Beeinträchtigung längerfristig beschäftigen wollen.
"Werkstattbefähigung"

Foto: Merklinger
Darunter versteht man den Anspruch auf den Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), der neben einer bestimmten Qualifizierung auch eine volle Erwerbsminderung voraussetzt. Als voll erwerbsgemindert gilt, wer aufgrund von Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden am Tag erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der Erwerbsminderung erfolgt durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung. Beschäftigte in einer WfbM gelten zudem als "Rehabilitanden". Damit kommt zum Ausdruck, dass es sich, im Gegensatz zu einer Behinderung, prinzipiell um eine vorübergende Beeinträchtigung handeln kann. Eine anerkannte Schwerbehinderung ist daher kein Aufnahmekriterum für Werkstätten.
Einarbeitungsphase
Der endgültigen Beschäftigung auf dem Betrieb geht immer eine längere Phase der Arbeitserprobung und Einarbeitung voraus, die über ein bis drei Jahre gehen kann. Während dieser "Praktikumszeit" besteht kein echtes Arbeitsverhältnis. Die Agentur für Arbeit kommt als Kostenträger für die Finanzierung dieser Einarbeitungsphase auf. Bei gegenseitigem Einverständnis erfolgt danach die Weiterbeschäftigung im Betrieb.
Weiterbeschäftigung mit und ohne regulären Arbeitsvertrag
Bei einer Weiterbeschäftigung gibt es zwei grundsätzliche Optionen. Es folgt entweder eine reguläre Anstellung mit Arbeitsvertrag und ortsüblicher oder tarifgebundener Entlohnung. Solche Regelungen finden sich zum Beispiel in einem Inklusionsbetrieb oder beim sogenannten "Budget für Arbeit". Im Gegensatz dazu gibt es Modelle, bei denen nach der Praktikumsphase lediglich ein "arbeitnehmerähnliches" Rechteverhältnis ohne regulären Arbeitsvertrag besteht. Dies ist zum Beispiel der Fall beim sogenannten "Außenarbeitsplatz" einer WfbM und beim Modell "Andere Leistungsanbieter" (ALA). Hier soll erst nach mehrjähriger Beschäftigung, wenn möglich, der Wechsel in ein reguläres Arbeitsverhältnis mit entsprechender Bezahlung und einer Entbindung aus der Werkstatt folgen. Wie diese Modelle im Einzelnen aussehen, wird nachfolgend noch näher erläutert.
Lohnkostenzuschüsse

Foto: Colourbox.de, MarianVejcik
Die Entlohnung des Mitarbeiters ist bei den genannten Beschäftigungsvarianten grundsätzlich verschieden . Beim "arbeitnehmerähnlichen" Rechteverhältnis behält der Mitarbeiter seinen Werkstatt-Status bei, auch wenn er auf dem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet. Er erhält dementsprechend auch weiterhin einen festgelegten Werkstattlohn. Ein Anspruch auf Lohnkostenzuschuss durch die öffentliche Hand besteht in diesen Fällen nicht. Besteht jedoch ein reguläres Arbeitsverhältnis mit entsprechend regulärer Entlohnung, so sind nach SGB IX je nach Beeinträchtigung des Mitarbeiters staatliche Lohnkostenzuschüsse von bis zu 75 % des eigentlichen Entgeltes möglich. Diese staatliche Förderung wird direkt an den Betrieb ausgezahlt und soll einen finanziellen Ausgleich für die verminderte Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters schaffen (siehe Übersicht).
Übersicht langfristige Beschäftigungsmodelle| Arbeitsverhältnis | Arbeitsplatzmodell | Anspruchsberechtigte | Entlohnung/Finanzierung |
|---|
| Außenarbeitsplatz einer WfbM | arbeitnehmerähnliches Rechteverhältnis ohne Arbeitsvertrag | Voll erwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf den Besuch einer WfbM (Werkstattbefähigung); der tatsächliche Besuch einer Werkstatt ist aber nicht zwingend notwendig | Werkstattlohn |
|---|
| Andere Leistungsanbieter (ALA) | arbeitnehmerähnliches Rechteverhältnis ohne Arbeitsvertrag | Voll erwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf den Besuch einer WfbM (Werkstattbefähigung); der tatsächliche Besuch einer Werkstatt ist aber nicht zwingend notwendig | Werkstattlohn |
|---|
| Budget für Arbeit | Reguläres Arbeitsverhältnis mit Arbeitsvertrag | Voll erwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf den Besuch einer WfbM (Werkstattbefähigung); der tatsächliche Besuch einer Werkstatt ist aber nicht zwingend notwendig | Reguläre Entlohnung + dauerhafter staatlicher Lohnkostenzuschuss |
|---|
| Inklusionsbetrieb | Reguläres Arbeitsverhältnis mit Arbeitsvertrag | Menschen mit Schwerbehinderung oder besonderem Unterstützungsbedarf (seltener WfbM-Beschäftigte) | Reguläre Entlohnung + staatlicher Lohnkosten-zuschuss für max. 5 Jahre |
|---|
Außenarbeitsplatz

Foto: Schönach
Beim Außenarbeitsplatz wechseln die Mitarbeiter aus dem Arbeitsbereich einer WfbM oder Jugendliche nach einer zweijährigen Berufsbildungsmaßnahme gemäß § 57 SGB IX in ein Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes. Die Berufsbildungsmaßnahme findet ebenfalls in einer WfbM statt und entspricht quasi einer Grundausbildung. Sie soll auf den Arbeitsbereich einer WfbM vorbereiten. Beim Wechsel auf einen landwirtschaftlichen Betrieb bringen die Mitarbeiter also immer bereits eine gewisse Arbeitserfahrung mit.
Werkstatt-Status bleibt
Der Mitarbeiter behält beim "Außenarbeitsplatz" seinen "Werkstatt-Status" bei. Er wird weiterhin über die WfbM betreut, entlohnt und sozialversichert. Der landwirtschaftliche Betrieb zahlt lediglich einen individuell vereinbarten Geldbetrag direkt an die Werkstatt. Dieser Betrag beläuft sich in der Regel auf 300 bis 500 Euro monatlich. Die Finanzierung des Arbeitsplatzes ist also weiterhin an die Werkstatt gebunden.
Übrigens kann für Familienmitglieder, zum Beispiel für den Sohn oder die Tochter auch auf dem eigenen Betrieb ein Außenarbeitsplatz eingerichtet werden, wenn Anspruch auf den Besuch einer WfbM besteht.
Wo findet der Betrieb geeignete Mitarbeiter?
Erste Anlaufstellen sind die sogenannten Integrationsfachdienste (IFD) der staatlichen Kostenträger (Agentur für Arbeit, Rentenversicherer). Sie geben erste Informationen, helfen bei der Suche nach geeigneten Mitarbeiter und übernehmen bei einer Beschäftigung die sozialpädagogische Begleitung (regelmäßige Hofbesuche für ca. eine Stunde in der Woche). Weitere Beratung bieten außerdem die Fachdienste der Lebenshilfe in Schweinfurt "Mensch Inklusive" und in Bamberg "Integra Mensch" sowie privatwirtschaftliche Unternehmen wie zum Beispiel die Sozialteam GmbH und Conceptnext (siehe Link-Liste). Die genannten Beratungsangebote richten sich sowohl an potentielle Arbeitnehmer als auch an Arbeitgeber.
Andere Leistungsanbieter (ALA)

Foto: Colourbox.de 55297819 #232219
Bei dem Modell "Andere Leistungsanbieter" (ALA) übernimmt der landwirtschaftliche Betrieb quasi selbst die Rolle einer WfbM. Er muss sich dafür zunächst als "Anderer Leistungsanbieter" über ein sogenanntes Teilhabeplanverfahren anerkennen lassen. Für die Anerkennung ist die Vorlage eines "Fachkonzeptes andere Leistungsanbieter" bei der Bundesanstalt für Arbeit und eine Musterleistungsvereinbarung der bayerischen Bezirke notwendig. Der Bezirk prüft das vorgelegte Fachkonzept. Den weiteren Verhandlungen mit dem Bezirk folgt gegebenenfalls der Abschluss mit entsprechenden Leistungsvereinbarungen.
Arbeitsverhältnis wie in einer WfbM
Die Rahmenbedingungen für ALA sind der einer WfbM ähnlich. Voraussetzung ist ebenfalls eine "Werkstattbefähigung" des Mitarbeiters. Mit dem Mitarbeiter besteht wie in einer WfbM ein "arbeitnehmerähnliches Rechteverhältnis" ohne regulären Arbeitsvertrag und ohne Anspruch auf Mindestlohn. Von einer Aufnahmeverpflichtung gegenüber Menschen mit Behinderungen bleibt der ALA im Gegensatz zu einer WfbM ausgenommen.
Finanzierung
Auch vom ALA erhält der Mitarbeiter einen "Werkstattlohn". Der ALA übernimmt wie in einer WfbM außerdem die Sozialversicherungsbeiträge, bekommt diese vom Leistungsträger aber monatlich erstattet (außer Unfallversicherung und Insolvenzumlage). ALA können außerdem für den zusätzlichen Betreuungsaufwand entsprechende Betreuungspauschalen (Tagessätze) mit dem Leistungsträger vereinbaren und abrechnen. Dies ist zum Beispiel bei einem Außenarbeitsplatz einer WfbM nicht möglich.
Wo findet der Betrieb geeignete Mitarbeiter?
Hier gilt das Gleiche wie beim "Außenarbeitsplatz" einer WfbM.
Budget für Arbeit

Foto: Bayerischer Rundfunk
An das Modell des Außenarbeitsplatzes angelehnt ist das sogenannte "Budget für Arbeit". Auch hier wechseln die Mitarbeiter aus dem Arbeitsbereich einer WfbM oder Jugendliche nach einer zweijährigen Berufsbildungsmaßnahme in ein Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes. Im Gegensatz zu einem Außenarbeitsplatz besteht jedoch ein reguläres Arbeitsverhältnis mit ortsüblicher oder tarifgebundener Entlohnung. Die Finanzierung des Arbeitsplatzes ist nicht mehr an eine WfbM gebunden, sondern läuft über den Betrieb selbst und kann mit einem staatlichen Lohnkostenzuschuss gefördert werden.
Antragstellung beim Sozialträger
Um ein "Budget für Arbeit" in Anspruch nehmen zu können, muss eine "Werkstattbefähigung" des Mitarbeiters und ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsvertragsangebot eines Arbeitsgebers vorliegen. Dann kann der zukünftige Mitarbeiter, also der "Budgetnehmer" und nicht der Betrieb beim Sozialkostenträger (in Bayern die Bezirke) einen Antrag auf das "Budget für Arbeit" stellen. Nach Bewilligung erhält der Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 % des regulären Entgeltes. Diesen zahlt der Kostenträger direkt an den Arbeitgeber aus, nicht an den Mitarbeiter. Je nach Bundesland ist der Betrag jedoch gedeckelt, in Bayern sind es derzeit rund 1.500 Euro monatlich.
Wo findet der Betrieb geeignete Mitarbeiter?
Erste Anlaufstellen sind die Integrationsfachdienste (IFD) oder der technische Beratungsdienst des Inklusionsamtes, in Bayern das Zentrum Bayern Familie Soziales (ZBFS). Diese ermitteln auch den Umfang der Leistungsminderung vor Ort. Weitere Beratungsstellen sind die Fachdienste der Lebenshilfe in Schweinfurt (MenschInklusive) und Bayreuth (IntegraMensch) sowie privatwirtschaftliche Unternehmen wie zum Beispiel Sozialteam GmbH und Conceptnext GmbH.
Inklusionsbetrieb

Foto: Petra Kopfinger
Die Zahl der Inklusionsbetriebe hat in den letzten zehn Jahren in Deutschland um etwa 40 % auf insgesamt 975 Betriebe im Jahr 2020 zugenommen (bag-if, 2022). Neben den WfbM bieten sie für Menschen mit Beeinträchtigung die aussichtsreichste Möglichkeit auf einen dauerhaften Arbeitsplatz. Inklusionsbetriebe ermöglichen im Gegensatz zur WfbM sozialversicherungspflichtige, reguläre Arbeitsverhältnisse. Bei einer Festanstellung sind Lohnkostenzuschüsse mit bis zu zwei Dritteln des eigentlichen Entgelts möglich. Der Lohnkostenzuschuss ist allerdings auf längstens fünf Jahre beschränkt und muss vom Betrieb beim Kostenträger (Agentur für Arbeit) jährlich neu beantragt werden. Zuschüsse für die Ausstattung des Arbeitsplatzes sind bis zu 55.000 Euro möglich.
Anerkennungsverfahren notwendig
Auch hier muss der Betrieb zunächst ein Anerkennungsverfahren durchlaufen. Allerdings ist dies kein förmliches Anerkennungsverfahren wie zum Beispiel bei ALA, sondern ein relativ einfaches Antragsverfahren. Der Antrag ist beim Inklusionsamt zu stellen. Die Anerkennung kann sich auf den ganzen Betrieb oder nur auf einzelne Betriebsbereiche beziehen. Jedoch müssen Inklusionsbetriebe sich verpflichten, mindestens 30 % bis maximal 50 % ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung zu besetzen. In der Praxis finden sich Inklusionsbetriebe in der Landwirtschaft daher fast nur im Gemüsebau oder im Garten- und Galabau, wo der Arbeitskräftebedarf das ganze Jahr über entsprechend hoch ist. Mehr zum Anerkennungsverfahren und sonstige rechtliche Bestimmungen finden sich in den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter (siehe Link-Liste nach dem nächsten Absatz).
Anspruchsberechtigte
Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich schwerbehinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf. 2017 ist gemäß reformiertem Bundesteilhabegesetz der Kreis auf psychisch kranke Menschen, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, erweitert worden. Bei Festanstellung ist aber immer eine anerkannte Schwerbehinderung oder Gleichstellung Voraussetzung, für die Praktikumsphase reicht ein individueller Unterstützungsbedarf aus.
Anmerkung: Die Informationen im Beitrag wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Ihre Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert, und auch Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit wird nicht erhoben.
Ansprechpartnerin:
Theresia Nüßlein
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökonomie
Hans-Loher-Str. 32, 94099 Ruhstorf a.d.Rott
Tel.: +49 8161 8640-4639
E-Mail: Diversifizierung-IBA@LfL.bayern.de




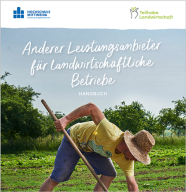
![]()





