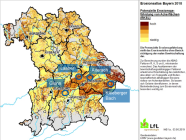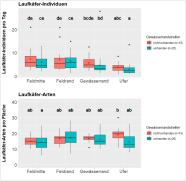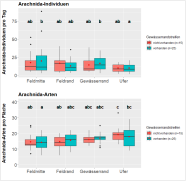Forschungs- und Innovationsprojekt
Evaluierung der Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen (AUM) auf Insekten – Teilprojekt 1: AUM in Ackerlandschaften

Gewässerrandstreifen
Fallstudie zur Wirkung von Maßnahmen mit multifunktionalem Potenzial im Bayerischen EPLR 2014-2020 auf Insektenbiomasse und -diversität und Ableitung von Optimierungsmöglichkeiten (Teilprojekt 1 – Acker)
Mit dem Kulturlandschaftsprogramm kann der Freistaat Bayern Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftung im Ackerland gewähren. Inwieweit Agrarumweltmaßnahmen (AUM) zum Schutz der Biodiversität beitragen, ist jedoch nicht ohne weiteres ableitbar. Untersuchungen zur Wirkung der AUM auf die Insektenfauna von landwirtschaftlichen Nutzflächen sind daher dringend erforderlich. In Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) wird seit 2019 das Projekt "Evaluierung der Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen auf Insekten" durchgeführt. Die Teilprojekte 1 (AUM in Ackerlandschaften) und 2 (AUM im Grünland) sind an der LfL, während das Teilprojekt 3 (AUM im Vertragsnaturschutz (VNP)) am LfU angesiedelt ist. Ziel dieses Projektes ist es, mit modernen wissenschaftlichen Methoden verlässliche Daten und Fakten zu generieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Gewässerrandstreifen bei Mengkofen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Erfassung der Insekten im Feld und am Gewässerrand
Folgende Fragestellungen werden im Teilprojekt 1 AUM in Ackerlandschaften untersucht:
- Wie wirken sich Gewässerschutzstreifen an kleineren Gewässern in ackerdominierten Gebieten auf die Insektenbiomasse, Individuenanzahl und Artenvielfalt der flugfähigen Insekten aus?
- Wie wirken sich Gewässerschutzstreifen an kleineren Gewässern in ackerdominierten Gebieten auf die Individuenanzahl und Artenvielfalt der epigäischen Arthropoden aus?
- Welche Vegetations- und Bewirtschaftungsfaktoren im Gewässerrandstreifen wirken sich besonders positiv auf die Insektenfauna aus?
Ziele
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Gelbbindige Furchenbiene
Methode und Beschreibung der Fallentypen
Untersuchungsgebiete
Versuchsdesign
Die Fallen wurden im Sommer über drei Fangperioden à zwei Wochen aufgestellt. Die Leerung der Fanggefäße erfolgte jeweils nach einer Woche. In allen Untersuchungsgebieten fand die erste Fangperiode im Mai/Juni, die zweite im Juni/Juli und die dritte Fangperiode im August/September statt. Über den gesamten Untersuchungszeitraum und über alle Untersuchungsgebiete hinweg wurden so insgesamt 480 Malaisefallenproben und 3840 Bodenfalleneinzelproben gewonnen.
Fallentypen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Malaisefalle
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Bodenfalle
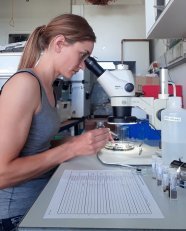 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Sortieren und Zählen der Insekten
Ergebnisse der Malaisefallenfänge
Insektenbiomasse
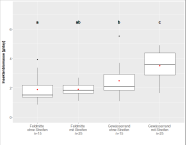 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Insektenbiomasse
Artenvielfalt der Insekten
- Anzahl der OTUs (operational taxonomic unit), ungefiltert: Sequenzgruppen, die sich nicht mehr als 2% voneinander unterscheiden und damit Gruppen von eng verwandten Individuen klassifizieren.
- Anzahl der BINs (Barcode Index Numbers), gefiltert auf Arthropoden und BOLD Hit ID >97%: Gruppen von OTUs, welche eine sehr hohe Übereinstimmungsrate mit den tatsächlichen Arten haben.
- Artenminimum, gefiltert auf Arthropoden: dabei wurde jede OTU-Gruppe, die nicht bis auf Art zugeordnet werden konnte, nur dann als eigene Art gezählt, wenn keine genauere taxonomische Einheit in dieser Probe vertreten war. So wurde z.B. ein nur bis zur Familie bestimmbares Tier nur dann als eigenständige Art in der Probe gezählt, wenn kein Tier aus derselben Familie auf Gattungs- oder Artebene nachgewiesen wurde.
- Fulldet-Arten, gefiltert auf Arthropoden: hierbei wurden nur die OTU-Gruppen gezählt, die bis auf Artebene zugeordnet werden konnten.
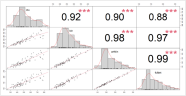 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Korrelationsmatrix der Artenzahlen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Anzahl der Arten
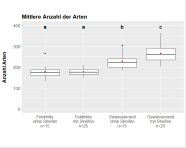 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Mittlere Anzahl der Arten
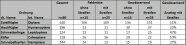 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Gesamtarten pro Ordnung
Aktivitätsdichte der Fluginsekten
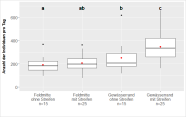 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Durchschnittliche Anzahl der Individuen pro Tag
Wirkung des Gewässerrandstreifens auf die Familie der Schwebfliegen
Ergebnisse der Bodenfallenfänge
Aktivitätsdichte der epigäischen Arthropoden
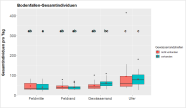 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Anzahl der Individuen in den Bodenfallen
Wirkung des Gewässerrandsteifens auf die Familie der Laufkäfer
Wirkung des Gewässerrandsteifens auf die Gruppe der Spinnentiere
Fazit
Projektinformation
Projektleitung: Roswitha Walter
Wissenschaftliche Begleitung: Johannes Burmeister, Sebastian Wolfrum
Projektbearbeiter: Sabine Birnbeck, Mahmud Tawfik
Weitere Unterstützung durch die Arbeitsgruppe Bodentiere: Sabine Topor, Michael Weber, Josefa Weinfurtner
Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.07.2022
Projektpartner: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)