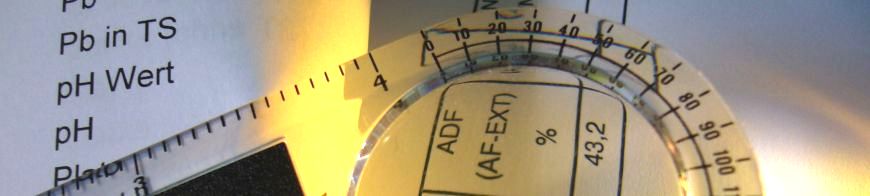Forschungs- und Innovationsprojekt
Bayerischer Qualitäts- und Futterweizenanbau unter den Vorgaben der DüV 2020

Die Backqualität des Weizens wird am Getreidemarkt vor allem anhand des Rohproteingehalts definiert. Einige ertragreiche Sorten, wie z.B. Asory, weisen auch bei geringem Rohprotein- und Feuchtklebergehalt eine gute Backqualität auf. Ein hoher Ertrag bei gleichzeitig guter Backqualität führt zu einer effektiven Ausnutzung der Produktionsmittel. Aufgrund der derzeitig hohen Qualitätszuschläge steigt das Interesse an gut backfähigen Weizenpartien.
Novellierung der Düngeverordnung - Auswirkung auf die Weizenproduktion und Tierernährung
Ziel
Backqualitätsweizen
Futterweizen
Methode
Vorläufige Ergebnisse
Vorläufige Ergebnisse aus den Einzeljahren
Projektinformation
Projektleitung: Dr. Lorenz Hartl, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Züchtungsforschung Weizen und Hafer, IPZ2c
Projektbearbeitung: Annalisa Wiesinger
Laufzeit: 01.01.2021 – 31.12.2024
Fördernde Institution: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Förderkennzeichen: A/20/15
Kooperation:
IPZ 2a – Ulrike Nickl, Produktionssysteme Getreide
AL 2a - Analytik der Rohstoffqualität von pflanzlichen Produkten
LfL - Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft (ITE)
LfL - Institut für Agrarökonomie (IBA)
AELF Augsburg, Fachzentrum Pflanzenbau
AELF Deggendorf-Straubing, Fachzentrum Pflanzenbau
AELF Kitzingen-Würzburg, Fachzentrum Pflanzenbau
Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände
Bayerischer Müllerbund