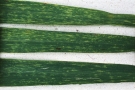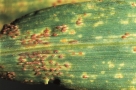Gerstenkrankheiten
- Schnee-
schimmel - Typhula-
Fäule - Gelbmosaik-
viren - Gelb- und Weizen-
verzwergungsviren - Halmbruch-
krankheit - Mehl-
tau
Schneeschimmel: Keimschäden, Schneefäule und Blattflecken
Schadbild
- keine oder schwächliche Keimlinge, z.T. korkenzieherartig verdreht
- nach Schneeschmelze Pflanzen reihen- oder nesterweise am Boden liegend, oft mit watteähnlichem Geflecht bedeckt
- nach Abtrocknen tote Pflanzenteile zunächst rötlich, später schmutzigweiß verfärbt
- „Auswintern" auch durch Typhula-Fäule oder Kahlfröste
- Blattbefall ist gekennzeichnet durch große, ovale wässriggraugrüne Flecken, später bräunlich mit rosa Sporenlagern
Befallsvoraussetzungen
- infiziertes Saatgut und/oder befallene Ernterückstände im Boden
- dichter, üppiger Wuchs im Herbst, Stresssituationen im Herbst und Winter (z.B. Sauerstoffmangel unter verharschter Schneedecke, Kahlfröste)
- lange Zeit Schneedecke auf ungefrorenem Boden. Blattsymptome vor allem nach anhaltend nass-kalter Witterung im Mai
Vorbeugende Bekämpfung
- gute Stroheinarbeitung; Bekämpfung von Quecken und anderen Ungräsern in allen Fruchtfolgegliedern
- Saatgut aus gesund abgereiften, Beständen
- scharfe Reinigung
- möglichst nur zertifizierte Ware
- feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett
- keine extrem frühe oder späte Saat der Wintergerste, keine zu dichte oder zu tiefe Kornablage
- verhaltene N-Düngung im Herbst
- Nachauflaufherbizide im Herbst nicht zu spät
- in jährlichen Befallslagen: keine Getreide-, Mais- oder Gräservorfrucht, Anbau von Sommerstatt Wintergerste
Gezielte Bekämpfung
- sorgfältige Saatgutbeizung mit schneeschimmelwirksamen Präparaten
- bei Strobilurinhaltigen Beizen oder Blattfungiziden sind Minderwirkungen durch resistente Schneeschimmel-Stämme möglich
- bei geschädigten Beständen im Frühjahr zeitige N-Düngung
- kein Fungizid gegen Blattbefall zugelassen
Typhula-Fäule
Schadbild
- gegen Winterende Vergilben der Gerste einzeln, reihen- oder nesterweise
- Absterben zunächst der äußeren Blätter, dann ganzer Pflanzen
- bei hoher Feuchte weißliches Pilzgeflecht
- auf abgestorbenen Pflanzenteilen dunkelbraune, stecknadelkopfgroße Dauerkörper
- Vergilben auch durch andere Pilz- oder Viruskrankheiten, Nährstoff- oder Wassermangel, Nässe- oder Kälteeinwirkung
- „Auswintern" gleichfalls nach Schneeschimmelbefall oder Frost
Befallsvoraussetzungen
- über mehrere Jahre lebensfähige Dauerkörper im Boden
- verbreiteter Wintergerstenanbau, enge Folge von Wintergetreide und/oder Gräsern
- leichte und lockere Böden
- üppige Herbstentwicklung
- Schwächung der Bestände durch Sauerstoff- und Nährstoffmangel, unsachgemäße Herbizidanwendung, Mehltau, Viruskrankheiten oder Kahlfröste
- anfällige Sorten
- kühler, feuchter Spätherbst, Schneedecke auf ungefrorenem Boden oder milde, regenreiche Winterwitterung
Vorbeugende Bekämpfung
- keine zu enge Folge von Wintergerste und anderen frühgesäten Wintergetreidearten und Gräsern – Wahl wenig anfälliger Sorten
- Saat nach Pflugfurche nur in gut abgesetzten Boden, nicht zu früh, zu dicht und zu tief
- dem Bedarf angepasste N-Düngung im Herbst
- nicht zu späte Anwendung von Herbiziden im Herbst
Gezielte Bekämpfung
- Befallsminderung durch Beizung mit speziellen systemischen Fungiziden
Gelbmosaikviren der Wintergerste (Barley yellow mosaic virus = BaYMV, Barley mild mosaic virus = BaMMV)
Schadbild
- im zeitigen Frühjahr auf Gerstenschlägen nesterartig bis großflächig Vergilbungen, die sich bei jedem Gerstenanbau ausdehnen
- befallene Pflanzen fahlgrün bis gelblich; auf den jüngsten Blättern punkt- oder strichelförmige Aufhellungen, die sich zu gelben Flecken vergrößern, später Vergilben dieser Blätter von der Spitze her
- bei zusätzlichem Witterungsstress Verbräunen der Vergilbungen
- verfärbte Blätter sterben ab
- kranke Pflanzen weniger winterhart, geringer bestockt, mit verkürzten Halmen, zum Teil vorzeitig absterbend oder ohne Ähren
- ab Einsetzen warmer, wüchsiger Witterung Wiederergrünen und normale Weiterentwicklung der Pflanzen
- intensivere Gelbfärbung auch bei Bodenverdichtung, Staunässe, Nährstoffmangel, Befall mit Typhula-Fäule oder Schneeschimmel
Befallsvoraussetzungen
- Mosaikviren an Bodenpilz über 20 Jahre lebensfähig
- im Herbst bei Bodenfeuchtigkeit auf Gerstenwurzeln übertragen
- bevorzugt auf schweren Böden, nach früher Gerstensaat und langer feucht-milder Herbstwitterung
- Virusvermehrung in der Pflanze und Ausbildung der Symptome erst nach dem Winter bei etwa 5-15 °C (Sortenunterschiede!)
- bei langanhaltend kühler Frühjahrswitterung daher Schädigung vieler Blattetagen, nach Erwärmung Neuzuwachs gesund
- meiste Sorten vollständig resistent gegen Virustyp 1, einzelne Sorten zusätzlich gegen Typ 2
Vorbeugende Bekämpfung
- keinen Bodenanhang (Maschinen!) aus verseuchten Flächen verschleppen, keine extrem frühe Wintergerstensaat
- in Befallsgebieten Anbau virusresistenter Wintergerstensorten oder Sommergerste
- für geschädigte Bestände keine weitere Herbizid- oder Krankheitsbelastung; frühzeitige N-Ausgleichsdüngung
Gelb- und Weizenverzwergungsviren (Barley yellow dwarf virus = BYDV, Wheat dwarf virus = WDV)
Schadbild bei Herbstinfektionen
- leuchtend gelbes Verfärben zuerst der älteren Blätter von der Spitze her
- Pflanzen im Wuchs gestaucht (verzwergt), starke Bestockung (grasartig), Absterben oder kümmerliche Entwicklung
- Krankheitsauftreten nesterweise, vermehrt am Feldrand
Schadbild bei Frühjahrsinfektionen
- Gelbfärbung des Fahnenblattes, vorzeitige Reife mit ungenügender Kornausbildung, vorzeitiger Befall mit Schwärzepilzen
- Gelbfärbung, insbesondere im Jugendstadium, auch durch Pilzbefall, Nährstoffmangel, Kälte, stauende Nässe oder zu niedrige pH-Werte
Befallsvoraussetzungen
- Virusinfektionen im Herbst von ausdauernden Gräsern in benachbartem Grünland, Feldrainen, von Ausfallgetreide, auch von Mais; im Frühjahr auch von befallenem Wintergetreide
- Flug und Vermehrung der Virusüberträger (BYDV durch Blattläuse, WDV durch eine Zikade) im Herbst und/oder Frühjahr
- Frühsaat der Wintergerste, verspätete Aussaat der Sommergerste
- Sonnige Herbst-, warme Frühjahrswitterung
Vorbeugende Bekämpfun
- keine extrem frühe Wintergersten-, jedoch frühe Sommergerstensaat
- Beseitigen des Ausfallgetreides, Kurzhalten von Wegrainen zur Zeit des Blattlausflugs
- Wahl frühreifer Sorten, dichter Bestand
Gezielte Bekämpfung
- zur Saatgutbeizung mit systemischen Insektiziden ist seit einigen Jahren kein Mittel mehr zugelassen
- Bekämpfung der Blattläuse nach Zuflug im Herbst bzw. Frühjahr; gegen Zikaden nur Teilerfolge; Warndiensthinweise beachten
- in geschädigten Beständen frühzeitige N-Düngung
Halmbruchkrankheit
Schadbild
- Ende der Bestockung auf Blattscheiden eng begrenzte, glasig-braune Flecke, teilweise im Befallszentrum aufreißend
- Gegen Vegetationsende an Halmbasis Verbräunungen und Vermorschen, schließlich parasitärer Halmbruch
- Sommergerste i.d.R. nicht gefährdet. Flächige Verbräunungen an der Basis junger Pflanzen, Halmbasisverbräunungen sowie Lagern auch nach Befall mit Fusarium (insbesondere nach Maisvorfrucht!) und anderen Fußkrankheitserregern
Befallsvoraussetzungen
- im Boden jahrelang infektionsfähige Stoppelreste
- frühe Wintergerstensaat
- im Frühjahr dichtstehende, üppige Bestände
- Sorten mit hoher Bestandesdichte
- feuchte Standorte, mittlere und schwere Böden
- Vorfrucht oder Vorvorfrucht Weizen, Gerste, Triticale oder Roggen
- in Vorkulturen Ungräser, insbesondere Quecken
- Gründüngung unmittelbar vorausgehend
- lange feuchtkühle (0-9 °C) Witterungsabschnitte im Herbst und Frühjahr, früher Vegetationsbeginn
Vorbeugende Bekämpfung
- Sorgfältige Stoppeleinarbeitung, Beschleunigung der Stoppelrotte durch Gründüngungsmaßnahmen, vor allem vor Nichtgetreidegliedern
- Wintergerstensaat nicht zu früh, zu dicht und zu tief
- Ungräserbekämpfung
- bedarfsgerechte N-Düngung
Gezielte Bekämpfung
- Fungizideinsatz gegen Halmbrucherreger von Beginn des Schossens bis Spitzen des Fahnenblattes ist in der Regel nur dann wirtschaftlich, wenn gleichzeitig Blattkrankheitserreger zu bekämpfen sind.
- Warndiensthinweise beachten
- bei Lagergefahr Anwendung von Wachstumsreglern
Mehltau
Schadbild
- auf Blattspreiten und -scheiden erst spinnwebartig zarte, weiße Pusteln, später filzartige Überzüge
- Vergilben und schließlich Verbräunen der Befallsflächen, bei hoher Pusteldichte ganzer Blätter
- braune Blattflecke bei ungünstigen Infektionsbedingungen
- nach Herbstbefall Gerste weniger frostresistent und für Typhula anfälliger
- Vergilben der untersten Blätter auch bei Trockenheit, Nährstoffmangel, Kälte oder Nässe
- braune Blattflecken durch Netzfleckenkrankheit oder Magnesiummangel
Befallsvoraussetzungen
- befallene Ernterückstände und befallenes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen
- verbreiteter Wintergerstenanbau, Sommergerste neben Wintergerste, Anbau nur weniger und anfälliger Sorten, Frühsaat der Wintergerste und verspätete Aussaat der Sommergerste
- hohe Anbauintensität
- leichte (= warme) Böden, windgeschützte Lagen
- sonnige Herbstwitterung, zeitige Erwärmung im Frühjahr, hohe Luftfeuchtigkeit, aber kein heftiger Regen
- nach dem Schossen tritt gewisse Altersresistenz ein
Vorbeugende Bekämpfung
- sorgfältiges Einarbeiten von Ernterückständen und Ausfallgetreide
- keine extrem frühe Wintergerstensaat
- frühe Saat der Sommergerste – Wahl wenig anfälliger Sorten
- möglichst keine Sommergerste neben Wintergerste
- bedarfsgerechte N-Düngung
Gezielte Bekämpfung
- manche Saatgutbeizen mit Nebenwirkung auf Mehltau-Frühbefall
- Blattbehandlung mit einem Mehltaufungizid im Frühjahr bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 50 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen
- Zwerg-
rost - Gelb-
rost - Netzflecken-
krankheit - Rhynchosporium-
Blattfleckenkrankheit - Ramularia-
Sprenkelkrankheit - Physiologische
Blattflecke - Gerstenflug-
brand
Zwergrost
Schadbild
- auf Blattspreiten punktförmige, orangebraune Rostpusteln, meist von ausgeprägten, hellen Höfen umgeben
- Pusteln zerstreut angeordnet, später auch auf Blattscheiden und Ähren
- bei hoher Pusteldichte Vergilben und Absterben ganzer Blattpartien
Befallsvoraussetzungen
- befallenes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen
- verbreiteter Wintergerstenanbau, Frühsaat der Wintergerste und verspätete Frühjahrsaussaat der Sommergerste, Anbau von Sommergerste neben Wintergerste, anfällige Sorten
- hohe Anbauintensität
- warme Anbaulagen
- nach relativ hohen Frühjahrstemperaturen warmer Frühsommer (18-25 °C) mit Taunächten
Vorbeugende Bekämpfung
- sorgfältige Beseitigung des Ausfallgetreides
- keine extrem frühe Saat von Wintergerste, jedoch frühe Saat von Sommergerste
- Sommergerste nicht unmittelbar neben Wintergerste
- Wahl wenig anfälliger, zumindest frühreifender Sorten, insbesondere bei Sommergerste
- N-Düngung ausgewogen
- keine reifeverzögernde N-Spätdüngung
Gezielte Bekämpfung
- systemische Rostfungizide bei Befallsbeginn, bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 30 % Befallshäufigkeit der Haupttriebe, sowie Infektionsausweitung bei günstiger Witterung
- Strobilurin- und Carboxamidhaltige Präparate mit lang anhaltender Protektivwirkung
- Zwergrost der Gerste leichter bekämpfbar als Braunrost in anderen Getreidearten
Gelbrost
Schadbild
- auf Blattspreiten gelb-orange Rostlager, ohne deutlichen Hof, streifenförmig zwischen den Blattnerven; später auch auf Blattscheiden, Halmen, Spelzen und Grannen
- befallene Pflanzenteile vergilben und sterben ab, erst in Streifenform, dann großflächig
- Auftreten bei Weizen und Triticale häufiger als bei Gerste
- strichförmige Verbräunungen auch durch Netzflecken- oder Streifenkrankheit, streifenförmige Blattbeschädigungen durch Larven der Getreidehähnchen und Gerstenminierfliegen
Befallsvoraussetzungen
- Gelbrostauftreten im Vorjahr, gute Übersommerung des Schadpilzes bei regenreicher Witterung auf Ausfallgetreide und guter Start bei mildem Herbst und mildem oder schneereichem Winter auf Winterung
- ausgedehnter Gerstenanbau mit nur wenigen Sorten, Frühsaat der Wintergerste, Nachbarschaft von Sommergerste und Wintergerste, anfällige Sorten
- hohe Anbauintensität
- Frühjahr und Frühsommer feucht, 10-15 °C; bei Temperaturen über 20 °C Pilzentwicklung gehemmt
Vorbeugende Bekämpfung
- sorgfältige Beseitigung des Ausfallgetreides – Wintergerstensaat nicht extrem früh
- Sommerung räumlich getrennt von Winterung, möglichst nicht in Hauptwindrichtung von Wintergerste
- bedarfsgerechte N-Düngung
Gezielte Bekämpfung
- wegen anfangs ungleichmäßiger Befallsverteilung intensive Bestandskontrollen
- systemische Rostfungizide bei ersten Befallsnestern
- bei anhaltendem Befallsdruck Maßnahme wiederholen, späteste Spritzung zum Beginn der Gerstenblüte
Netzfleckenkrankheit
Schadbild
- auf Blattspreiten braune Netzflecken- oder Fleckensymptome von unregelmäßiger Form und Größe
- Blattflecken meist von gelbem Hof umgeben
- Blattflecken meist von gelbem Hof umgeben
- Blattbräunungen auch noch im vergilbten Gewebe erkennbar
Befallsvoraussetzungen
- befallene Ernterückstände, erkranktes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen; infiziertes Saatgut
- verbreiteter Wintergerstenanbau, anfällige Sorten, frühe Saat der Wintergerste, Nachbarschaft von Sommergerste und Wintergerste; feuchte Lagen
- Wechsel von ein- bis mehrtägigen Niederschlagsperioden und Sonnentagen mit Tageshöchsttemperaturen > 20 °C; Taunächte für Infektion ausreichend
Vorbeugende Bekämpfung
- sorgfältige Einarbeitung von Ernterückständen, Förderung der Stoppelrotte
- frühzeitige Beseitigung von Ausfallgetreide
- kein Anbau von Gerste nach Gerste sowie von Sommer- neben Wintergerste
- Wahl wenig anfälliger Sorten
Gezielte Bekämpfung
- Saatgutbeizung
- speziell gegen Netzfleckenerreger wirksame Fungizide ab Beginn des Schossens bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 20 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen
- Strobilurin- und Carboxamidhaltige Präparate mit lang anhaltender Protektivwirkung, die allerdings durch zunehmende Resistenzbildung beeinträchtigt werden kann
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit
Schadbild
- auf Blattspreiten und Blattachseln anfangs ovale, wässrig-graugrüne Flecke (1-2 cm lang), später fahlgraues Zentrum mit dunkelbraunem Rand schließlich unregelmäßig geformte Flächennekrosen, Absterben der Blattspreiten und Blattscheiden
- anfangs meist nesterweises Auftreten im Bestand
- ähnliche Symptome nach unsachgemäßer Anwendung von Kontaktherbiziden und Blattdüngern
Befallsvoraussetzungen
- befallene Ernterückstände auf Bodenoberfläche und Ausfallgetreide; infiziertes Saatgut
- verbreiteter Wintergerstenanbau, enge Fruchtfolgestellung der Gerste, anfällige Sorten, flache Stoppelbearbeitung, Frühsaat der Wintergerste, feuchte Standorte
- häufige Blattbefeuchtung, Temperaturen 10-20 °C; z. B. nach hohen März-Temperaturen und häufigen Niederschlägen in den Folgemonaten
Vorbeugende Bekämpfung
- sorgfältige Einarbeitung von Ernterückständen und Ausfallgetreide, Förderung der Stoppelrotte
- kein Anbau von Gerste nach Gerste sowie Sommergerste neben Wintergerste
- Wahl wenig anfälliger Sorten
Gezielte Bekämpfung
- Saatgutbeizung
- Befallsfortschritt während der Schossperiode unterbinden, daher kurativer Fungizideinsatz (d.h. nach Infektionsperioden) bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle (z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 50 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen) und zumindest kurzen Niederschlägen für die Schaderregerausbreitung
Ramularia-Sprenkelkrankheit
Schadbild
- nach dem Ährenschieben erscheinen auf Blattspreiten und Blattscheiden erste schokoladenbraune Flecke
- die 1-2 mm2 großen Flecke sind seitlich von den Blattadern begrenzt und meistens von einem gelben Hof umgeben
- bei stärkerem Auftreten erhalten Blätter, später auch Halme, Spelzen und Grannen, ein gesprenkeltes Aussehen
- im Lupenbild erkennt man zuerst blattunterseits die reihig angeordneten weißen Sporenträgerbüschel des Pilzes, diese auf älteren, teils nekrotisierten Blättern auch schon im Herbst/Frühjahr erkennbar
Befallsvoraussetzungen
- Ramularia lässt sich mit empfindlichen Methoden bereits auf dem Saatgut und in frühen Entwicklungsphasen nachweisen, ohne typische Schadsymptome zu entwickeln
- jegliche (auch noch nicht sichtbare) Schwächung des Pflanzengewebes begünstigt dieAusbreitung
- der Erreger besiedelt als Schwächeparasit durch physiologischen Stress vorgeschädigtes Gewebe besonders schnell
- er bildet Giftstoffe, die ihre Schadwirkung erst unter Einwirkung von Strahlung entwickeln, womit auch eine Wechselwirkung zu physiologischen Blattflecken besteht
Vorbeugende Bekämpfung
- Maßnahmen, die physiologischen Stress vorbeugen, wie ausgewogene Düngung, optimale Bestandesdichte und Vermeidung von Lager
Gezielte Bekämpfung
- Fungizidmischungen mit Chlorthalonil zeigen vom Fahnenblatt-Stadium bis Mitte Ährenschieben ausgebracht, eine gute Wirkung
- gegen die leistungsfähigen Carboxamide und Prothioconazol treten dagegen zunehmend Resistenzen auf
- Ertragswirkung abhängig vom Zeitpunkt des Auftretens der Symptome und der Abreifedauer am Standort
Physiologische Blattflecke
Schadbild
- auf den Blattspreiten entstehen punktförmige Vergilbungen, die innerhalb weniger Tage in rotbraune Sprenkelnekrosen übergehen
- auf Standorten mit extremem Auftreten übersäen die Verbräunungen das ganze Blatt, das dann vorzeitig abreift
- schließlich verbräunen selbst die Blattscheiden, und die Grannen verfärben sich grauweiß
- die Symptome beginnen nach Erreichen des Fahnenblatt-Stadiums meist auf dem dritten Blatt von oben (F-2) und setzen sich auf F-1 und das Fahnenblatt fort. Bei Überlappen oder Verdrehen von Blättern bleibt der beschattete Blattteil zunächst noch grün
Befallsvoraussetzungen
- das Schadgeschehen ist auf einen Komplex von Stressfaktoren zurückzuführen
- der wichtigste ist hohe Sonneneinstrahlung in den empfindlichen Stadien Fahnenblatt-Stadium bis Beginn der Kornbildung
- Hitze, Trockenheit, verminderte Verfügbarkeit von Haupt- und Spurennährstoffen sowie Luftschadstoffe können die Belastung verstärken
- diese Faktoren führen in der Pflanze zu einem oxidativen Stress: Giftige Sauerstoffverbindungen zerstören die betroffenen Zellen
Vorbeugende Bekämpfung
- wichtigste Maßnahme in Risikolagen ist der Anbau weniger empfindlicher Sorten
- ausgewogene Düngung, nicht zu geringe Bestandesdichten und Vermeidung von Lager beugen gegen starke Einstrahlung auf den Blattapparat vor
Gezielte Bekämpfung
- vor allem die ramulariawirksamen Fungizide, ab vollständiger Ausbildung der oberen Blätter ausgebracht, können in der Pflanze das antioxidative Schutzsystem anregen und damit das Schadgeschehen mindern
Gerstenflugbrand
Schadbild
- nach Ährenschieben Ähren mit schwarzbraunen Brandsporenmassen, anfangs von einem silbrigen Häutchen bedeckt
- nach Verwehen der Brandsporen leere Ährenspindeln
Befallsvoraussetzungen
- unsichtbar infiziertes Saatgut aus flugbrandbefallenen Beständen
- anfällige Sorten; lange, offene Gerstenblüte; Frühsaat der Wintergerste, verspätete Aussaat der Sommergerste
- während Gerstenblüte kühle Witterung; nach Aussaat relativ warme Keimbedingungen
Vorbeugende Bekämpfung
- Aussaat von zertifiziertem Saatgut, bei eigenem Nachbau nicht aus flugbrandbefallenen Beständen
- keine extrem frühe Saat der Wintergerste, frühe Saat der Sommerung
Gezielte Bekämpfung
- Beizung mit speziell gegen Gerstenflugbrand zugelassenen Präparaten