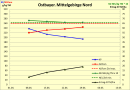Einen Schnitt voraus – mit dem LfL-Aufwuchsmonitoring
Bayernweite Aufwuchsuntersuchungen zum ersten Schnitt im Grünland und Kleegras 2026 – Teilnehmer gesucht!
LfL-Aufwuchsmonitoring 2026
Der optimale Schnittzeitpunkt ist entscheidend für die Qualität von Silagen. Mit Hilfe der bayernweiten Aufwuchsuntersuchungen soll die richtige Entscheidung für den 1. Schnitt vereinfacht werden. Auch in diesem Jahr findet wieder das bayernweite Aufwuchsmonitoring der LfL zum 1. Schnitt statt.
Die bayernweiten Untersuchungsergebnisse sind dabei in sechs Agrargebiete zusammengefasst. Die Einordnung der einzelnen Regionen Bayerns zu den Agrargebieten erfolgt nach klimatischen und geografischen Gegebenheiten (siehe Karte).
Wie funktioniert das?
Durch wöchentliche Probenahmen von Wiesen- und Kleegrasbeständen mit anschließender Nährstoffuntersuchung im Labor kann die Entwicklung der Bestände anhand der Inhaltsstoffe verfolgt werden.
Wer kann daran teilnehmen?
Mitmachen können Betriebe, sowohl konventionell als auch ökologisch bewirtschaftet, aus ganz Bayern mit Grünland bzw. Kleegrasflächen (Namen werden nicht veröffentlicht). Den Teilnehmern fallen keine Kosten für Porto und Laboruntersuchung an.
Was wird benötigt?
Von der LfL werden bereitgestellt : Probenbeutel, Versandboxen, Portomarken und Anleitung zur Probenanmeldung.
Selbst bereitgestellt werden muss:
- Für den Standort repräsentative Wiese oder Kleegrasfläche (mind. 50% Kleeanteil)
- (Motor-)Sense, Balkenmäher oder Kreiselmähwerk (kein Rasenmäher)
- Meterstab/Maßband, Rechen, Waage
Wie erfolgt die Probenahme?
Das Aufwuchsmonitoring startet bei einer Aufwuchshöhe von 8 bis 10 cm – circa Anfang bis Mitte April (genauer Beginn wird bei Teilnahme bekannt gegeben).
Ablauf:
- Probe immer sonntags oder montags auf der ausgewählten Fläche abmähen (Flächenbedarf: 1. Probenahme ca. 9-12 m2, weitere Probenahmen ca. 4-8 m2)
- Mähgut wiegen und eine Mischprobe per Post an das LfL-Labor Grub schicken
- Mischprobe im Online Laborprogramm „web-FuLab“ anmelden
- Erstteilnehmer erhalten ein Erklärvideo zum Ablauf der Probenahme
Ende
Die wöchentliche Probenahme endet zwei Wochen, nachdem auf dem Betrieb siliert wurde.
Was bekommen die teilnehmenden Betriebe?
- Wöchentliche Nährstoffergebnisse der eigenen Aufwuchsproben
- Zusätzlich als Dankeschön: Kostenlose Untersuchung einer separaten Futterprobe auf Inhaltsstoffe, Gärparameter und Mineralstoffe
Interesse geweckt???
Rückblick 2025 - Erst zögerlich im Wachstum aber dann doch recht schnell silierreif
Definitiv anders als in den vergangenen Jahren gab es in diesem Jahr keinen Wetterkrimi beim Silieren des 1. Schnittes. Viele sonnige Tage in Kombination mit milden Temperaturen sorgten ab Anfang Mai in ganz Bayern für ideale Erntebedingungen.
TM-Ertrag:
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren waren die diesjährigen TM-Erträge zum 1. Schnitt allerdings geringer. Die lange Frühlingstrockenheit, geringe Niederschlagsmengen und immer wiederkehrende Nachtfröste hemmten das Massewachstum. Mit den Regenfällen in der ersten Maiwoche konnten die Bestände zwar nochmal an Masse zulegen, aber das Defizit nicht aufholen. Die TM-Erträge schwankten sowohl zwischen und auch innerhalb der Agrargebiete sehr deutlich. Für eine hohe Grobfutterqualität sind aber trotzdem primär die Inhaltsstoffe und Energiegehalte der Grasbestände entscheidend. Denn lieber eine gute Klasse als viel Masse mit wenig Klasse.
ADFom:
Anders als in den vergangenen Jahren waren trotz des sehr trockenen und warmen Frühjahrs die Grasbestände mit einem sehr niedrigen Verholzungsgrad in die Vegetation gestartet. Die warme und trockene Witterung führte aber trotzdem zu einem zügigen Anstieg der ADFom-Gehalte, jedoch nicht so stark wie es in den Vorjahren der Fall war. Der Zeitraum für den optimalen Schnittzeitpunkt wurde daher mit Ausnahme des Agrargebiets Ostbayerisches Mittelgebirge Nord und den höheren Lagen des Alpenvorlands und Ostbayerischen Mittelgebirge Süd ab KW 18 (28.04) und in den anderen Gebieten ab KW 20 (12.05) erreicht.
Rohprotein (CP):
Trotz der geringen Niederschlagsmengen im Frühjahr starteten die Rohproteingehalte auf einem zufriedenstellenden Niveau. Die Verholzung im Gras führt immer automatisch zu einer „Verdrängung“ der Rohproteingehalte. Zum Zeitraum des optimalen Schnittzeitpunkts lagen die CP-Gehalte im Mittel bei allen Agrargebeiten im angestrebten Orientierungsbereich von 160-170 g/kg TM.
Energie (NEL):
Der Abfall der Gehalte an Rohprotein und Anstieg der ADFom- Gehalte führte automatisch zu einem Rückgang der Energiegehalte. Auch die NEL-Gehalte lagen in KW 18 und KW 20 im gewünschten Bereich von 6,6 MJ NEL/kg TM.
Anhand der Gehalte an CP, ADFom und NEL konnte der 1. Schnitt in diesem Jahr definitiv mit einer aus Sicht der Inhaltsstoffe und Energiegehalte zufriedenstellen Qualität zum idealen Zeitpunkt ins Silo eingefahren werden.
Wiesen weiter im Auge behalten
Mit der warmen Witterung wachsen die Folgeschnitte auf den Wiesen zügig heran. Durch die zunehmenden Tageslängen bis Mitte Juni und den milden Temperaturen wird jetzt das generative Wachstum der Gräser gefördert. In diesem Stadium bildet das Gras statt Blattmasse in erster Linie Stängel zur Blütenbildung aus. Dadurch steigen bereits bei geringem Blattwachstum die ADFom-Gehalte den Folgeschnitten schneller an. Somit sollten Folgeschnitte zum Silieren noch vor dem Ähren- und Rispenschieben gemäht werden.
Ergebnisse der Grünland-Probeschnitte - Entwicklung der Rohnährstoffe und Energiegehalte

Ostbayerisches Mittelgebirge Süd
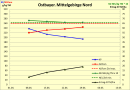
Ostbayerisches Mittelgebirge Nord

Jura, Keuper, Nordbayer. Hügelland
Kleegrasbestände in den einzelnen Agrargebieten
Neben dem Dauergrünland wurden auch Kleegrasbestände im Rahmen des Aufwuchsmonitorings zum 1. Schnitt beprobt. Voraussetzung war, dass die Bestände einen Leguminosenanteil von mindestens 50 % aufweisen.
Die Beprobung fand in den Agrargebieten Tertiärhügelland, Jura, Keuper, Nordbayerisches Hügelland und Ostbayerisches Mittelgebirge Süd statt (siehe Karte oben).
TM-Ertrag:
Die Kleegrasbestände starteten wie auch das Dauergrünland aufgrund der Frühlingstrockenheit zunächst mit sehr geringen wöchentlichen Zuwächsen. Erst mit der wiederkehrenden Bodenfeuchte konnten sich die Leguminosen richtig entwickeln und die TM-Erträge stiegen sprunghaft an. Im Zeitraum des optimalen Schnittzeitpunkts (KW 19; 05.05) lagen die TM-Erträge in allen drei beprobten Agrargebieten im Mittel bei 28 dt TM.
ADFom:
Wie auch im Dauergrünland waren die ADFom-Gehalte trotz der Frühjahrstrockenheit bei Beginn des Monitorings sehr gering. Mit dem Massezuwachs ist der Verholzungsgrad zwar zügig angestiegen, allerdings nicht in so stark wie in den vergangenen Jahren. Anhand der Entwicklungen der ADFom-Gehalte wurde der Zeitraum für den optimalen Schnitt ab KW 19 (05.05) erreicht.
Rohprotein (CP):
Mit dem Anstieg der Verholzung sinkt automatisch der Rohproteingehalt in den Pflanzen ab. Besonderheit bei den Leguminosen ist, dass sie aber bei wiederkehrender Bodenfeuchte erneut Stickstoff aus dem Boden mobilisieren können und dadurch der CP-Gehalt wieder ansteigen kann. Zum Zeitpunkt des optimalen Schnittzeitpunkts lagen die mittleren Rohproteingehalt mit 188 g/kg TM auf einem zufriedenstellenden Niveau.
Energie (NEL):
Der Abfall der Eiweiß- und gleichzeitige Anstieg der ADFom-Gehalte wirkt sich immer negativ auf die Energiegehalte aus. Jedoch konnten die gewünschten 6,6 MJ NEL/kg TM im Zeitraum des optimalen Schnittzeitpunkts erreicht werden.
Die Witterung in diesem Jahr machte es auch bei den Kleegrasbeständen möglich, diese bei optimaler Schnittreife zu ernten. Die Gehalte an CP, ADFom und NEL zeigen, dass die Qualität des 1. Schnitts 2025 definitiv auf zufriedenstellenden Niveau liegt, wenn auch die TM-Erträge vielerorts geringer sind als in den vergangenen Jahren.
Ergebnisse der Kleegras-Probeschnitte - Entwicklung der Rohnährstoffe und Energiegehalte

Kleegras Tertiärhügelland

Kleegras Ostbayer. Mittelgebirge Süd

Kleegras Jura, Keuper, Nordbay. Hügelland
Wie werden die Inhaltsstoffe bestimmt?
Mehr zum Thema
Grünland umfasst ca. ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche Bayerns. Es dient in erster Linie der Produktion von Futter und damit der Erzeugung von Milch und Fleisch. Daneben trägt es zum Schutz von Boden und Grundwasser bei, ist ein wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere und prägt das Landschaftsbild wesentlich.
Mehr
Flora und Fauna der Kulturlandschaft stehen in enger Wechselwirkung mit der Landbewirtschaftung. Zur Erhaltung und Entwicklung von Biodiversität und einer lebenswerten Landschaft betreiben wir Forschung und entwickeln Grundlagen-Konzepte.
Mehr

 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden